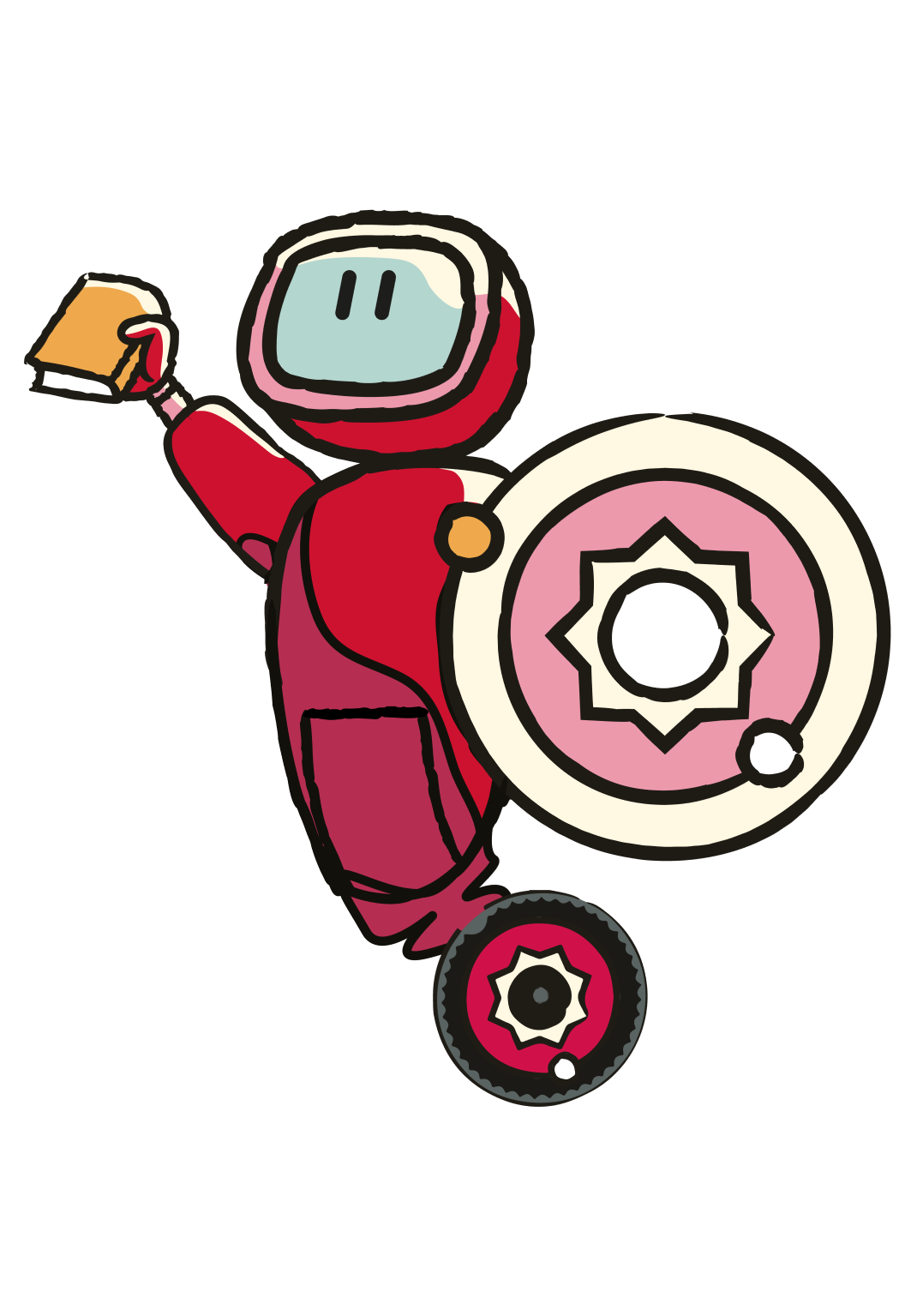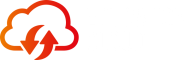In einer zunehmend digitalisierten Bildungslandschaft gewinnt das Thema Datenautonomie an Schulen rasant an Bedeutung. Mit der Nutzung digitaler Lernplattformen, Cloud-Diensten und Kommunikations-Tools fließen tagtäglich riesige Mengen an personenbezogenen Daten durch die digitalen Kanäle des Schulalltags. Wer kontrolliert diese Daten? Wer darf sie einsehen, speichern oder analysieren? Und wie können Schulen sicherstellen, dass die Rechte von Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und Eltern gewahrt bleiben?

Was bedeutet Datenautonomie?
Datenautonomie bezeichnet die Fähigkeit von Individuen und Institutionen, selbstbestimmt über die Erhebung, Speicherung, Nutzung und Weitergabe ihrer Daten zu entscheiden. Für Schulen heißt das: Sie sollen die Kontrolle über die von ihnen genutzten digitalen Systeme und die dort verarbeiteten Daten behalten – ohne sich in Abhängigkeit von großen Tech-Konzernen zu begeben oder unbewusst sensible Informationen preiszugeben.
Die Herausforderung: Datenschutz vs. digitale Effizienz
Moderne Schul-IT verspricht Effizienz: Lernmanagementsysteme, digitale Klassenbücher, Videokonferenzen, KI-basierte Tools zur Leistungsanalyse – all das kann pädagogisch wertvoll sein. Doch die Kehrseite zeigt sich oft in einer Abhängigkeit von globalen Plattformen, die ihre Server im Ausland betreiben und Daten für kommerzielle Zwecke auswerten könnten. Hier kollidieren pädagogische Innovationsfreude und datenschutzrechtliche Verantwortung.
Warum Datenautonomie wichtig ist
- Schutz der Privatsphäre: Schülerinnen und Schüler haben ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Ihre Daten – insbesondere wenn sie Rückschlüsse auf Lernverhalten, psychische Verfassung oder Herkunft zulassen – müssen besonders geschützt werden.
- Digitale Souveränität der Schule: Schulen sollten selbst entscheiden können, welche Tools sie nutzen – auf Basis pädagogischer und datenschutzrechtlicher Kriterien, nicht aus Mangel an Alternativen oder aus wirtschaftlichem Druck.
- Transparenz und Vertrauen: Wenn Lehrkräfte, Eltern und Lernende nachvollziehen können, welche Daten warum und wie verarbeitet werden, entsteht Vertrauen in die digitale Schule.
- Vermeidung von Abhängigkeiten: Proprietäre Systeme mit geschlossenen Schnittstellen machen Schulen langfristig abhängig. Offene, datenschutzkonforme Plattformen bieten Unabhängigkeit und Flexibilität.
Wege zur Datenautonomie
- Digitale Bildung stärken: Lehrkräfte und Schulleitungen benötigen Fortbildungen, um digitale Tools souverän und datenschutzkonform einzusetzen.
- Open-Source-Lösungen fördern: Open Office und Open Cloud-Angebote Plattformen bieten datenschutzfreundliche Alternativen zu kommerziellen Produkten, die v.a. aus den USA und China stammen und somit nicht den Maßgaben der DSGVO entsprechen
- Anonymisierung/ Zugriffsbeschränkung: Mit einem DSGVO-konformen und betriebssystemübergreifenden Device Management System wie SOTI MobiControl können z.B. Google Accounts anonymisiert und der Zugriff auf den Google Playstore eingeschränkt werden. Damit ist der datenschutzkonforme Betrieb von z.B. EDLA Boards (die nur mit einem Google Account betrieben werden können) möglich.
- Datenschutz als Teil der Schulentwicklung: Datenautonomie sollte nicht als Hemmnis, sondern als strategisches Ziel in der Schulentwicklung betrachtet werden.
Fazit
Datenautonomie ist kein Nice-to-have, sondern ein Grundpfeiler für eine verantwortungsvolle, gerechte und zukunftsfähige Bildung. Schulen, die ihre digitale Infrastruktur selbstbestimmt gestalten, legen den Grundstein für eine neue Kultur der Datensensibilität – und für eine Schule, die das Recht auf Privatsphäre ebenso ernst nimmt wie das Recht auf Bildung.
Passend zum Thema

DSGVO-konform
Unser gesamtes Angebot ist konform mit der Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union (DSGVO) sowie dem Datenschutzgesetz der Schweiz (DSG).